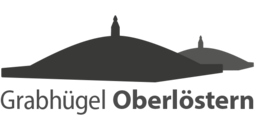Archäologische Erforschung in der Region Oberlöstern
Frühe Funde im Honigsack
Bereits 1936 wurden bei Rodungsarbeiten im Bereich des bewaldeten Flurstückes „im Honigsack“ Mauerzüge entdeckt und 1953 durch einen Lehrer mit seiner Schulklasse freigelegt. Hierbei handelte es sich um die Grundmauern eines römischen Gutshofes, einer „villa rustica“.
Keltische Grabhügel und gallo-römisches Gräberfeld
Die Existenz keltischer Grabhügel im Flurstück „Dachsheck“ war bereits bekannt, als die Entdeckung archäologisch bedeutender Befunde – vor allem durch den ehrenamtlichen Heimatforscher Markus Greten – das Staatliche Konservatoramt des Saarlandes zu eingehenden Untersuchungen veranlasste.
Ausgrabungen unter wissenschaftlicher Leitung
Zwischen 1991 und 1995 wurde das Gräberfeld im Bereich der gallo-römischen Grabhügel unter der wissenschaftlichen Leitung von Walter Reinhard ausgegraben und erforscht. Zwischen 2000 und 2001 wurden die beiden Grabhügel im Gelände rekonstruiert.
Entdeckung eines Umgangstempels
Nach Hinweisen eines Landwirtes aus Oberlöstern, der mit seinem Pflug auf harten Untergrund stieß, beauftragte das Landeskonservatoramt 1995 bis 1997 den Archäologen Alexander Recktenwald als örtlichen Grabungsleiter mit der näheren Untersuchung des Areals oberhalb der Grabhügel. Die entdeckte Steinpackung erwies sich dabei als Teil eines römerzeitlichen Umgangstempels.
Forschungspartnerschaft und systematische Untersuchung
Im Rahmen einer von 2010 bis 2022 laufenden Kooperation zwischen der Stadt Wadern und dem Arbeitsbereich Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie – zunächst der Universität Mainz, anschließend der Universität des Saarlandes – vertreten durch Frau Univ.-Prof. Dr. Sabine Hornung, wurden die archäologischen Denkmäler der Mikroregion Oberlöstern umfassend erforscht.
Einblicke in das Leben in keltisch-römischer Zeit
Das Denkmälerensemble – bestehend aus römerzeitlichem Gräberfeld und zugehörigem Gutshof, Tempelbezirk, Steinbrüchen sowie späteisenzeitlich-frührömischer Vorgängersiedlung – konnte systematisch untersucht und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Diese Arbeiten ermöglichen ein detailliertes Bild vom Leben der Menschen im Hochwald in keltisch-römischer Zeit, einschließlich handwerklicher und landwirtschaftlicher Tätigkeiten.
Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
Die archäologischen Forschungen zu dem genannten Denkmälerensemble wurden 2019 in Buchform publiziert. Die Region um Oberlöstern gilt heute als die am intensivsten erforschte, ländliche Siedlungskammer der keltisch-römischen Epoche im Hochwald.