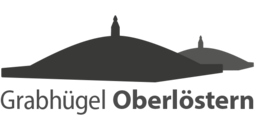Die Kelten und ihre Spuren im Hochwald
Frühkeltische Zeit
Begriff und Herkunft der „Kelten“
Die im 6. Jahrhundert v. Chr. von griechischen Historikern wie Herodot eingeführten Begriffe „Keltoi“ oder „Galatai“ bezeichnen keine in sich geschlossene Volksgruppe, sondern wurden zunächst als Sammelbegriffe für die Menschen Westeuropas verwendet. Die Römer übernahmen diese Bezeichnungen als „Celtae“ oder „Galli“ für die Bewohner des heutigen Frankreich, Belgien und Westdeutschland bis zum Rhein und übertrugen sie später auf ähnliche Gemeinschaften.
Kulturelle Merkmale und Verbreitung
Heute versteht man unter „Kelten“ verschiedene Volksgruppen in Mitteleuropa, die während der Eisenzeit von Südostengland, Frankreich und Nordspanien im Westen bis nach Westungarn, Slowenien und Nordkroatien im Osten und von Oberitalien im Süden bis zum nördlichen Rand der deutschen Mittelgebirge verbreitet waren. Kulturelle Übereinstimmungen und sprachliche Verwandtschaft lassen sich nachweisen – vor allem durch archäologische Funde, da schriftliche Selbstzeugnisse fehlen.
Eisenzeitliche Kulturen: Hallstatt und Latène
Die mitteleuropäische Eisenzeit wird in zwei große Kulturphasen unterteilt: die frühkeltische „Hallstattkultur“ (ca. 800–450 v. Chr.) und die jüngere „Latène-Kultur“ (450 v. Chr. – ca. 15 v. Chr.). Diese Einteilung stützt sich auf Unterschiede in der materiellen Kultur und den Bestattungsbräuchen.
Die Hunsrück-Eifel-Kultur im Hochwald
Ab dem späten 5. Jahrhundert v. Chr. häufen sich in der Hochwaldregion Hinweise auf dichte Besiedelung, weite Handelskontakte und eine ausgeprägte soziale Hierarchie. Aufgrund der reichen Grabbeigaben in Hügelgräbern lässt sich die Region der sogenannten „Hunsrück-Eifel-Kultur“ zuordnen. Diese entwickelte sich ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. zwischen Mittelrhein und Luxemburg und ging ab etwa 250 v. Chr. in die Kultur der „Treverer“ über.
Fürstengräber im Stadtgebiet Wadern
Auch im Stadtgebiet Wadern finden sich monumentale Hügelgräber aus dem 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., die aufgrund ihrer reichen Ausstattung als „Fürstengräber“ gelten. Die Elite wurde unverbrannt mit zahlreichen Beigaben unter bis zu 20 Meter großen Grabhügeln beigesetzt. Die Gräber lagen oft an exponierten Stellen oder Verkehrswegen. Besonders hervorzuheben ist die Grabhügelgruppe von Gehweiler, in der unter anderem eine italienische Bronzekanne als Importgut entdeckt wurde – ein deutliches Zeichen für weitreichende Handelsbeziehungen.